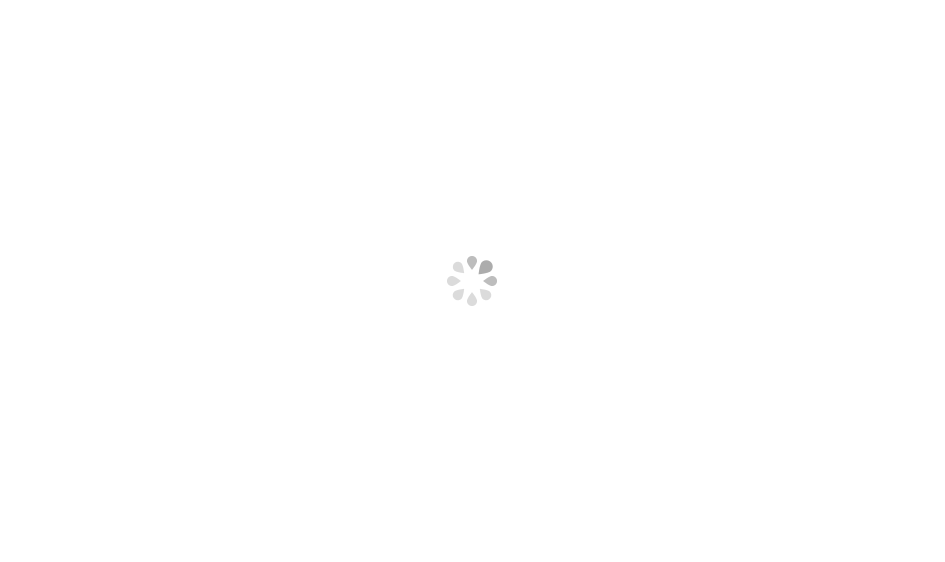In einem gesunden Erdreich werden Pflanzenteile durch Bakterien, Pilze und Würmer zersetzt – so entsteht organisches Material: Humus. Ein wichtiges Kriterium für die Bewertung der Bodenqualität ist der Humusanteil. Das Problem bei der Landwirtschaft: Durch die Bewirtschaftung wird der Humus im Boden abgebaut und verbraucht.
Primäres Ziel der konventionellen Landwirtschaft ist der maximale Ernteertrag. Diese Bewirtschaftung entzieht dem Boden viele Nährstoffe und steht im Kontrast zur Erhaltung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit. Dies wird durch den Einsatz von Düngemitteln aus der Fabrik kompensiert.
In der biologischen Landwirtschaft wird hingegen organisch gedüngt: vor allem mit Mist, Gülle und Kompost. Weiter helfen Ernterückstände und in Bio-Dünger enthaltener Stroh, dass in der Erde neuer Humus entstehen kann. Ebenfalls wichtig im Bio-Landbau ist die Einhaltung der vorgeschriebenen Fruchtfolge.
Durch eine wechselnde Bepflanzung bleibt die Bodensubstanz – im Vergleich zu einer Monokultur – langfristig im natürlichen Gleichgewicht. Regenwürmer und andere Organismen lockern den Untergrund auf und helfen bei der Bewässerung der tieferen Schichten – auch das ist wichtig für die Entstehung von neuem Humus. Auf diese Weise bleibt der Boden in der Bio-Landwirtschaft lebendig.
Die Untersuchungen des FiBL haben ergeben, dass die Bio-Landwirtschaft hinsichtlich Bodenqualität 20 bis 50 Prozent besser abschneidet. Der Grund ist der höhere Humusgehalt und die grössere Zahl an Bodenorganismen, dank denen er sich selbständig regenerieren kann.